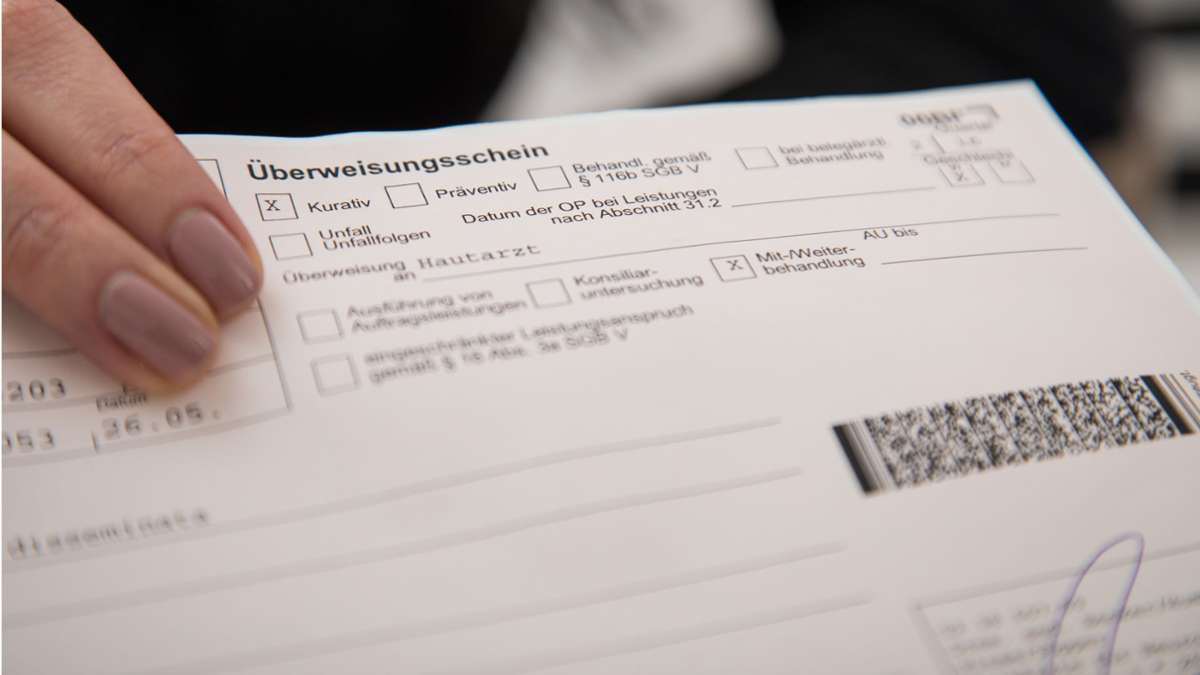Neben einem soliden Fachwissen und praktischer Erfahrung braucht ein Arzt vor allem eins: Zeit zum Zuhören. Doch gerade daran mangelt es vielen Medizinern im Praxis- und Klinikalltag. Das Gespräch mit dem Patienten ist zu einer oft lästigen Pflicht geworden. Während diese klare Aussagen erwarten, antworten Mediziner oft mit Phrasen und Fachchinesisch.
Dr. Gregory House ist Spezialist für Diagnostik. Ein Arzt mit genialem Gespür für außergewöhnliche und seltene Krankheitsbilder. Dr. House ist arrogant, nervig und zynisch, aber er hört seinen Patienten sehr genau zu. Ihre gesamte Persönlichkeit und Krankengeschichte sind Teil der Diagnose und des Heilerfolgs. Schade nur, dass der brillante Dr. House bloß eine Fiktion ist, Star der gleichnamigen TV-Kultserie aus den USA.
Verstehen Sie Ihren Doktor?
In deutschen Praxen und Kliniken sind Mediziner, die zuhören, eher rar gesät. Wenn Arzt und Patient reden, dann meistens aneinander vorbei. „Für viele Patienten wäre es das Beste, es würde nichts sonst getan, außer mit ihnen verständig zu reden“, meint ein Leitender Arzt für Innere Medizin aus einer Münchner Klinik.
Untersuchungen zeigen, dass es um die psychosoziale Kompetenz der Mediziner schlecht bestellt ist. Die Erklärungen des Patienten werden mitunter schon nach 20 Sekunden durch Fragen unterbrochen.
Sieben bis acht Minuten dauert im Schnitt eine Arzt-Sprechstunde
Laut Statistik bleiben Patienten durchschnittlich sieben bis acht Minuten in der Sprechstunde, um ihrem Arzt sagen, was sie plagt. Wenn der Doktor es besonders eilig hat, ist das Gespräch schon nach 4,5 Minuten beendet.
Nicht gerade viel, um all die Ängste und Fragen loszuwerden und eine sinnvolle Therapieanleitung mit nach Hause zu nehmen. „Heute ist die Kommunikation zwischen Arzt und Patient der Technologie gewichen“, stellt der Wiener Medizinautor Konrad Brustbauer fest.
Der Patient: Kunde oder Objekt?
Die Sprache, das wichtigste Instrument im Umgang mit dem Patienten, scheint vielen Ärzten abhanden gekommen zu sein. In der Sprechstunde herrscht allzu häufig Sprachlosigkeit. Der Patient ist zum „Objekt degradiert“ und zum „Kunden im Gesundheitssystem“ gestempelt worden, kritisiert der Salzburger Herzchirurg Felix Unger.
Hat nicht jeder eine solche Situation schon einmal erlebt? Man betritt das Behandlungszimmer. Ein kurzer Gruß. "Hallo!" Der Arzt blickt einen an, hört kurz zu und schaut dann auf seinen Monitor oder füllt die Karteikarte aus. Zum Schluss spuckt der Drucker ein Rezept aus. Gute Besserung. "Tschüss!" Das war’s!
Nach Daten des Sozialverbands VdK kommt der Patient in einer normalen Sprechstunde im Schnitt 106 Sekunden zu Wort.
Gemeinsam geht es besser
Behandlungen sind am erfolgreichsten, wenn sie auf gemeinsamen Entscheidungen von Arzt und Patient beruhen. Darin dürften sich Ärzte und Patienten einig sein. Doch die Arzt-Patienten-Praxis sieht allzuoft ganz anders aus. Da 30 bis 40 Prozent der Erkrankungen somatoform seien – also seelische Ursachen haben, die sich in körperlichen Symptomen ausdrücken –, ist nichts so wichtig wie die Kunst des Zuhörens.
Nach Ansicht der AOK führt die gestörte Kommunikation nicht nur zu unzufriedenen Patienten, sondern auch zu Missverständnissen bei der Medikamenteneinnahme und falsch verstandenen Diagnosen. Die ganzheitliche Betrachtung des Menschen, wie sie in der alternativen Medizin selbstverständlich ist, wird in der Schulmedizin - immer noch - häufig vernachlässigt.
Technik und Vergütung statt Empathie und Zuhören
Der Sozialverband VdK sieht einen Grund dafür im technisierten und auf maximale Effizienz gebürsteten Medizinbetrieb, in dem das Arzt-Patienten-Verhältnis in einem engen Zeitkorsett funktionieren muss. Beide seien Teil eines komplizierten Vergütungssystems, das für technische Leistungen „viel mehr Honorar als für ein Patientengespräch“ vorsieht, kritisiert der VdK.
Das bestätigt auch Gertrud Demmler vom Vorstand der Siemens Betriebskrankenkassen (SBK): „Geld verdient der Arzt nicht mit Zuhören, sondern mit Aktivitäten und Verrichtungen. So wenig wie es gelingt, Zuhören ausschließlich über Geld zu erzwingen, so sehr behindert das heutige Vergütungssystem das Zuhören in der Medizin.“
"Dr. med. Kümmerer": Eine selten gewordene Spezies von „Medicus“
Doch es geht auch anders. Es gibt sie noch, diese Dr. med. "Kümmerer, jene selten gewordene Spezies von „Medicus“, die eine Untersuchung nicht mit der Stoppuhr durchführen.
Ein Beispiel aus dem wahren Leben: Eine 60-jährige Frau ist an Grippe erkrankt. Der Arzt, der zum Hausbesuch kommt, ist Schulmediziner und anthroposophischer Arzt. „Ich nehme mir immer Zeit für meine Patienten“, erklärt er ihr gleich als er das Haus betritt, „bis zu einer Stunde.“
Aufmerksam hört er der Patientin zu, untersucht sie ausführlich und verabreicht ihr Medikamente, deren Wirkweise er genau erklärt. Zur Sicherheit schreibt er die Medikamentation auf einen Zettel auf. Die Frau kann ihr Glück kaum fassen: Ein Arzt, der wirklich zuhört und sich viel Zeit nimmt.
Frisch approbiert und schon unverständlich
Frisch approbierte Mediziner beherrschen Tausende Fachbegriffe. Selbstverständlich wenden sie diese im späteren Praxis-und Klinikalltag auch ausgiebig an. Und zwar dort, wo sie nur bedingt etwas zu suchen haben - im Gespräch mit dem Patienten. Für ihn sind Begriffe wie "Interstitielle Zystitis" (Harnblasenentzündung unklarer Herkunft) oder "Agranulozytose" (Mangel an weißen Blutkörperchen) nur unverständliche Laute aus dem Mund eines "Fachchinesisch" sprechenden Spezialisten.
Hinzu kommt: Beim Arztbesuch ist man häufig emotional angespannt, weil man nicht weiß, was einen plagt und erwartet. Jede Äußerung des Arztes wird vor dem Hintergrund eigener Ängste und Hoffnungen interpretiert. Die mangelhafte Kommunikation verstärkt nur das Gefühl, "der" Krankheit und "dem" Medizinbetrieb hilflos ausgeliefert zu sein.
„Worte sind preiswert und wirksam“
An renommierten Universitätskliniken wie Freiburg und Heidelberg untersucht man seit Jahren, wie das Arzt-Patienten-Gespräch optimiert werden kann. Im Medizinstudium nehme die Empathie mit dem Patienten ab dem dritten Semester rapide ab – der Zynismus dagegen zu, berichtet Jana Jünger, Fachärztin für Innere Medizin, und Leiterin des Instituts für Kommunikations- und Prüfungsforschung in Heidelberg aus ihr Erfahrungen.
Nach Angaben von Andreas Hofmann, Lehrbeauftragter am Institut für Allgemeinmedizin an der TU München, führt ein Arzt in seinem Berufsleben rund 16 000 Patientengespräche. Seine „Kunden“ wünschten sich nichts so sehr wie einen guten Zuhörer.
Auch Magnus Heier, Facharzt für Neurologe im nordrhein-westfälischen Castrop-Rauxel, ist fest davon überzeugt: „Würde in Klinik und Praxis mehr geredet, könnte die Medizin in Deutschland besser sein – und das, ohne teurer zu werden. Worte sind preiswert und wirksam!“